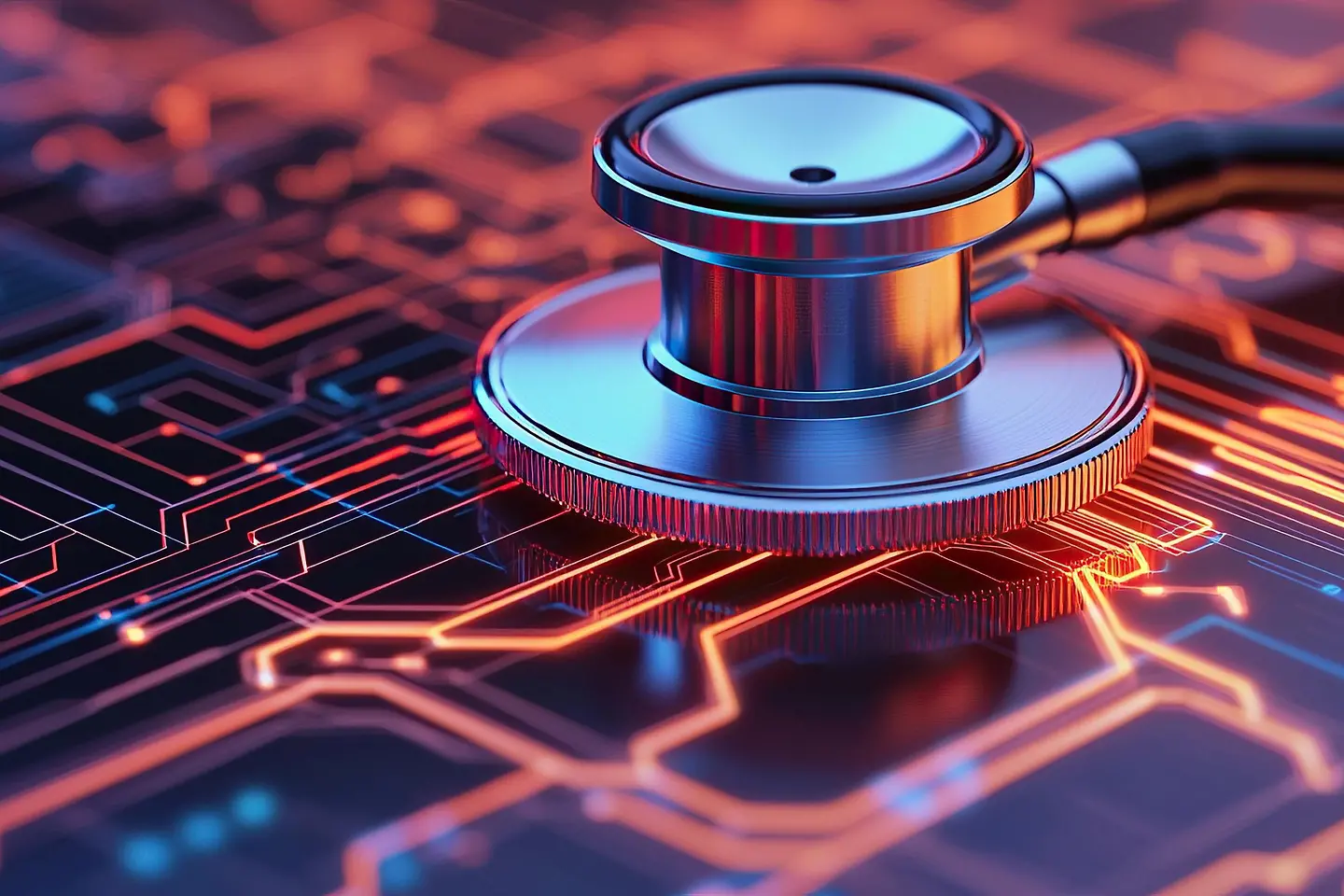
Es geht voran mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens – in Deutschland und Europa. Mit dem European Health Data Space (EHDS) entsteht gerade eine gemeinsame europäische Plattform, mit der wir Gesundheitsdaten viel umfassender nutzen können. Etwa, um die individuelle Versorgung zu verbessern. Oder der Forschung eine solide Datengrundlage für seltene Krankheiten zu verschaffen.
Der EHDS ist eine europäische Verordnung, die im März 2025 in Kraft getreten ist. In Deutschland wird der Datenraum schrittweise verpflichtend und soll zwischen 2027 und 2034 vollständig umgesetzt sein. Er verfolgt zwei zentrale Ansätze: die Primärnutzung, also den Austausch von Daten für die direkte medizinische Versorgung, und die Sekundärnutzung, also das Nutzen von Gesundheitsdaten für Forschung, Innovation und die politische Steuerung. Für Deutschland bedeutet dies, dass die nationale Infrastruktur nahtlos in den europäischen Rahmen eingebunden werden muss.
Wie spielt die zentral organisierte elektronische Patientenakte (ePA) in Deutschland und der EHDS zusammen? Der European Health Data Space und die ePA verfolgen ähnliche Ziele, basieren jedoch auf grundlegend unterschiedlichen IT-Architekturen. Während die ePA als zentrale Cloud-Infrastruktur konzipiert ist, setzt der EHDS auf einen dezentralen Datenraum. Er verbindet bestehende nationale Systeme über ein föderiertes Netzwerk. Daten bleiben lokal gespeichert, werden aber über standardisierte Schnittstellen und die zentrale Interoperabilitätsplattform MyHealth@EU austauschbar.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat bis 2025 elf Vorhaben zur Schaffung sicherer, souveräner und interoperabler Dateninfrastrukturen unterstützt. Rund 130 Millionen Euro flossen in Forschungs- und Innovationsprojekte. Die bekanntesten Beispiele sind Datenräume für Smart Living, Industrie 4.0, Mobilität und Catena-X.

Es ist höchste Zeit, Standards zu setzen und die Potenziale der Gesundheitsdaten für eine bessere Versorgung, innovative Forschung und nachhaltige Gesundheitssysteme zu nutzen.
Dirk Backofen, Leiter Digital Identity Business bei T-Systems
Catena-X ist das Datenökosystem der Automobilindustrie. Aktuell sind über 180 Unternehmen für diesen Datenraum registriert. Zu den Teilnehmern zählen große Automobilhersteller wie BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford, Renault und Volvo, zahlreiche Zulieferer wie Bosch, ZF, Schaeffler und Magna sowie IT- und Dienstleister, darunter auch T-Systems. Sie teilen Daten über mehrere Ebenen der Lieferkette und darüber hinaus – etwa für den gesamten Lebenszyklus einer Batterie.
Denn ab Februar 2027 wird für alle Batterien mit mehr als 2 kWh, die in der EU in Verkehr gebracht werden, der so genannte Battery Pass verpflichtend. Der Pass enthält Informationen zur Herkunft, zum CO2-Fußabdruck, zu verwendeten Materialien, zur Nutzung und zur Recycelbarkeit der Batterie. T-Systems hat eine Battery-Pass-Lösung entwickelt, die Daten aus allen Phasen des Batterie-Lebenszyklus aufbereitet und in einem digitalen Zwilling integriert. Der Austausch dieser Informationen erfolgt über den Datenraum Catena-X.
Und wo stehen wir im Gesundheitswesen? Hier wurden die ersten Weichen bereits in Spanien gestellt. T-Systems hat eine Plattform aufgebaut, um die Datenstrategie der Gesundheitsbehörde der Kanarischen Inseln – kurz SCS – umzusetzen. Der Fokus liegt zunächst auf den Ausgaben für Arzneimittel in Krankenhäusern und ambulanten Einrichtungen. Auf den Kanaren betragen diese rund 700 Millionen Euro. Dies ist der erste Schritt zu einem künftigen Datenbüro des SCS und die Basis für eine spätere Schnittstelle zum EHDS.
In Deutschland stehen wir vor einer doppelten Herausforderung: Einerseits die nationale Digitalisierung voranzutreiben, andererseits die europäische Harmonisierung zu gewährleisten. Die elektronische Patientenakte, die seit Ende April für alle gesetzlich Versicherten nutzbar ist, wird ab 1. Oktober Pflicht.
Mit Inkrafttreten des EHDS ergeben sich folgende Chancen und Herausforderungen:
Der EHDS setzt auf europäische Standards für elektronische Gesundheitsakten (European Health Records). Für Deutschland bedeutet das, die eigene ePA an diese Standards anzupassen, um grenzüberschreitend Daten austauschen zu können. Heißt: enge Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren im Gesundheitswesen.
Der EHDS stärkt die Rechte der Patientinnen und Patienten, ihre Daten selbst zu kontrollieren, zu teilen oder für Forschungszwecke freizugeben. Das passt gut zu den Prinzipien der deutschen ePA, die ebenfalls auf die aktive Beteiligung der Versicherten setzt. Allerdings müssen hier klare Regeln für den Datenschutz und die Datensicherheit etabliert werden, um das Vertrauen der Nutzer zu sichern. Bedeutet: Wege finden, den Zugang zu den Patientendaten selbstbestimmt und sicher über die Authentifizierung der European Digital Identity Wallet des Patienten zu ermöglichen. Insofern müssen wir die technischen und architekturellen Frameworks des EHDS und der EUDI-Wallet zusammen denken und umsetzen.
Durch einen umfangreichen europäischen Datensatz und die grenzüberschreitende Nutzung von Gesundheitsdaten können wir den Forschungsstandort Deutschland deutlich stärken. Denn die Verfügbarkeit hochwertiger, pseudonymisierter Daten beschleunigt das Entwickeln neuer Therapien und Medikamente.
Die Integration der deutschen ePA in die europäische Infrastruktur erfordert eine umfassende Modernisierung der bestehenden Systeme. Interoperabilität, Datensicherheit und Nutzerfreundlichkeit sind dabei zentrale Themen.
Fazit: Der European Health Data Space ist ein weiterer Hebel, um die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben. Die elektronische Patientenakte bildet dabei das Fundament, auf dem eine europäische, interoperable und datenschutzkonforme Gesundheitsinfrastruktur entstehen kann. Für die Akteure im Gesundheitswesen heißt das: Es ist höchste Zeit, Standards zu setzen und die Potenziale der Gesundheitsdaten für eine bessere Versorgung, innovative Forschung und nachhaltige Gesundheitssysteme zu nutzen. Nur gemeinsam können wir die Chancen des EHDS voll ausschöpfen und die Zukunft der europäischen Gesundheitsversorgung aktiv mitgestalten.